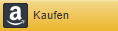Es war einmal ein kleines Navajo-Mädchen … Eine mitreißende Geschichte über schicksalhafte Begegnungen, unglaubliche Zufälle und eine Ranch in Colorado. Ein magischer Ort, an dem nicht nur ein Herz sein Zuhause findet. Bilderreich und hochemotional.
Der Staat verweigert dem Navajo Chayton Ironcloud die Vormundschaft für das Kind, das er wie eine Tochter liebt. Sein Ziehvater Mato Whitefeather greift nach dem letzten Strohhalm und bittet einen Mann um Hilfe, mit dem er seit drei Jahrzehnten keinen Kontakt hatte.
Die siebenjährige Sialea-lea lebt auf der Silverlight-Ranch bei den beiden Männern, die ihre hochschwangere Mutter bei sich aufgenommen hatten, ihre Familie sind. Damit, dass die anderen Kinder sie ausgrenzen, weil sie eine Navajo, Waise und zudem hochbegabt ist, kommt sie zurecht. Doch als Chayton nach einem heftigen Streit mit Mato die Ranch verlässt, bricht ihre kleine Welt zusammen.
Liz Winslow liebt ihre Arbeit mit hochbegabten Kindern, noch mehr den Mann, den sie Großvater nennt. Er hat sie, die damals vierjährige Waise, aufgenommen und ihr seine Welt zu Füßen gelegt. Daher denkt sie nicht zweimal nach, als Grandpa sie nach einem ominösen Anruf eines Mannes, der vor vielen Jahren sein Führer durch das Reservat der Navajo war, bittet, nach Colorado zu fliegen.
Einkaufen: Kindle | Taschenbuch | Hörbuch
Kennenlernen: Rieke Rothberg (Lisa Torberg)
Leseprobe (Kapitel 6)
Er bat sie, Sialea-lea lag bäuchlings auf den Heuballen. Weit entfernt von der Futterluke des Scheunenbodens, durch die das Heu nach unten in den Stall geworfen wurde, umso näher an dem im Giebel eingelassenen Fenster, durch das sie bis zum Hügelkamm sehen konnte. Die Federn des Traumfängers schienen zu tanzen, bewegten die hauchdünnen Schnüre und brachten die kleinen perlmuttfarbenen Perlen zum Glitzern. Der Hauch eines Lächelns überzog ihr Gesicht bei der Erinnerung an den kalten Wintertag, an dem Doli und sie daran gebastelt hatten. Ein Anflug von Traurigkeit verdrängte den Gedanken. Rasch sah sie weg. Wenn sie sich auf der weichen Decke, die sie zu Beginn des Winters von Dolis Bett genommen und hierhergebracht hatte, ein wenig streckte und den Kopf nach rechts wandte, konnte sie ein Fitzelchen vom See erkennen. Was sie jedoch nicht tat. Vielmehr lag ihr Blick nun wieder auf dem Mathematikheft zwischen ihren aufgestützten Armen. Den Bleistift hielt sie locker mit Daumen und Zeigefinger, ließ ihn hin und her schaukeln. Sie erfasste die Zahlen oberhalb und unterhalb des Strichs der Bruchrechnung. Weder überlegte sie noch rechnete sie, das war unnötig. Ihr Kopf machte alles ganz von selbst. Neun und zwölf ergab einundzwanzig, acht minus fünf ergab drei, die obere Summe geteilt durch die untere ergab sieben. Sie senkte die Spitze des Bleistifts auf das Papier und zeichnete unendlich langsam das Ergebnis an die dafür vorgesehene Stelle.
Mato, dessen Name in ihrer Sprache Bär bedeutete, nahm es mit den Hausaufgaben nicht so genau. Er kontrollierte sie nie, wusste ohnehin, dass sie fehlerlos waren. Aber er mochte es nicht, wenn sie sich stundenlang auf dem Heuboden verkroch. »Kinder müssen draußen spielen, Sonne tanken, in die Gerüche des Waldes und die Geräusche der Natur eindringen und sich mit der Erde verbinden, die zu uns spricht. Tust du das nicht, wirst du nie ein glücklicher und zufriedener Erwachsener werden, Lea.«
Sie hingegen mochte es nicht, wenn er Sialea-lea abkürzte, wie es andere machten. Doch bei denen störte es sie weniger. Die verstanden nicht, wie wichtig die Bedeutung eines Namens war. Lea konnte jede Frau heißen. Weiße und Schwarze, wahrscheinlich auch Chinesinnen, Japanerinnen, aber was wusste sie schon. Sicher war, dass Lea im Spanischen Lia hieß, mit Betonung auf dem I, und im Hebräischen Leah mit einem H am Ende. Das alles hatte sie recherchiert, so wie viele andere Sachen, die sie interessierten, und das war eine ganze Menge.
Früher, als sie noch kleiner war, hatte sie Chaytons Laptop verwendet, bis er ihr an ihrem letzten Geburtstag, dem siebten, das Tablet geschenkt hatte. Obwohl sie eigentlich längst nicht alt genug dafür war, hatte er gesagt. »Aber ich brauche meinen Laptop, wenn ich daheim bin, Sialea-lea. Ich kann nicht immer stundenlang warten, bis du mit deinen wichtigen Recherchen fertig bist, und da ich nachts zumindest ein paar Stunden schlafen will, habe ich keine Wahl.« Feierlich hatte er ihr das in ein Doppelblatt einer alten Denver Post verpackte flache Paket überreicht. Sein Gesicht hatte sich schmerzvoll verzogen, als das Zeitungspapier an der Stelle, wo es mit Scotch zugeklebt war, einriss. Sie hatte sich einen klitzekleinen Moment lang schuldig gefühlt – und dann aufgelacht. »Man könnte meinen, dass dir jemand das letzte Stück deiner Lieblingsschokolade weggenommen hat.« Es war ihm hoch anzurechnen, dass er nichts gesagt und sogar zu lächeln versucht hatte, was ihm nicht wirklich gelungen war. Was sie bis zu einem gewissen Punkt verstehen konnte, da sie ihre Bücher niemals aus der Hand gab, auch nicht die Schulbücher, obwohl man in viele davon reinschreiben konnte und sogar musste, was sie gar nicht mochte. Aber das waren Bücher, keine Zeitungen! Nur hatte Chayton eine eigenartige Beziehung zur Denver Post. Er hortete sie.
Stapelweise lagerten die täglichen Ausgaben nach Monaten geordnet neben seinem Schreibtisch, worüber sich Nascha, Matos Nichte, lautstark zweimal wöchentlich aufregte. So oft kam sie nämlich vorbei, um zu putzen, wie sie es in anderen Häusern auch machte. Allerdings bekam sie von ihrem Onkel fast den doppelten Lohn, und dennoch zeterte und jammerte sie fortwährend ab dem Moment, an dem sie durch die Haustür kam, bis sie die Ranch etwa vier Stunden später wieder verließ. Nascha war eine echte Nervensäge. Kein Wunder, dass sie weder einen Mann noch Kinder hatte, obwohl sie schon über vierzig war. Ihr Gezeter wegen Chaytons Zeitungen war nämlich nur die Spitze des Eisbergs. Genau genommen regte Nascha alles auf, was ihren Onkel betraf. Nascha verstand nicht, warum Mato sich nie eine Frau genommen oder zumindest ein Kind in die Welt gesetzt hatte. Weshalb er Chayton in sein Haus geholt hatte, obwohl dieser damals, als Teenager, aufsässig war und die beiden sich heiße Wortgefechte geliefert und dann tagelang angeschwiegen hatten.
Das war natürlich ewig her, daher wusste Sialea-lea nur das, was sie aufschnappte, denn so schweigsam die Navajo Fremden gegenüber waren, so redefreudig waren sie untereinander. Auch Mato und Chayton. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass diese beiden Männer sich früher nicht ausstehen konnten. Bevor sie zur Welt kam, hatten Mato und Chayton ihre damals hochschwangere Mutter bei sich aufgenommen und nie wieder gehen lassen. Seitdem Doli nicht mehr bei ihnen war, sorgten sie gemeinsam nur für sie. Normalerweise. Jetzt war sie mit Mato schon viel zu lang allein.
So lang war Chayton nie weg gewesen, seit Doli fort war. Doli, ihre Mutter, die Sialea-lea nie anders angesprochen hatte. Doli bedeutete in Diné Bizaad, der Sprache ihres Volkes, Bluebird. Navajo nannten ihre Kinder nicht nach irgendwelchen Schauspielern oder Popstars. Ihre Mutter hatte sie Sialea-lea genannt, kleiner Bluebird, da sie ihr Kind war. »Vereint bis in alle Ewigkeit«, hatte Doli immer nach dem Gutenachtkuss gesagt, bevor sie das Licht abgedreht und leise die Zimmertür hinter sich zugemacht hatte. Auch an dem Abend, von dem sie beide nicht hatten wissen können, dass es der letzte war, den sie gemeinsam ver-brachten. Alles war wie immer gewesen.
Am nächsten Tag war Doli verunglückt.
Auf dem Abstieg vom Mount Eolus über den Nordostgrat war sie vom Catwalk abgestürzt. Nicht, weil der Berg zu schwierig für sie war. Der höchste Viertausender der Needle Mountains war nur fünfzehn Kilometer Luftlinie entfernt. Sie hatten seine schroffen, aufragenden Gesteinsnadeln aus Granit von der Ranch aus im Blick. Doli hatte jede Route auf den Mount Eolus so gut gekannt, dass sie den Berg – wie Chayton, der ihr das Bergsteigen beigebracht hatte, oft scherzend gesagt hatte – auch mit geschlossenen Augen hätte besteigen können.
Nur eben nicht bei einem Unwetter.
Nicht, wenn die Temperatur innerhalb einer halben Stunde um mehr als zehn Grad fällt, was oberhalb der Baumgrenze selbst im Frühsommer bedeutet, dass sich die Regentropfen in Projektile aus Eis verwandeln. Dass der Stein anfriert und so glatt wird, dass auch die erfahrensten Alpinisten keine Chance haben, wenn sie ins Rutschen kommen, weder ihre Füße noch ihre Hände Griff haben. Erst recht nicht auf einem schmalen Gebirgsgrat wie dem Catwalk, wo es beiderseits steil in die Tiefe ging.
Sialea-lea konnte sich nicht erinnern, wie der weitere Sommer vergangen war. Ihren ersten Schultag hingegen würde sie nie vergessen. Niemand hatte mit dem Finger auf sie gezeigt, als Mato und Chayton mit ihr die Silverton School betreten hatten. Doch die Erwachsenen hatten teils neugierig zu ihnen gestarrt, teils verlegen an ihnen vorbei. Sie waren anders, waren Navajo, und sie war das Waisenmädchen, das seine Mutter verloren und nie einen Vater gehabt hatte. Was aber einfach so war. Eine Tatsache, mit der sie zurechtkam. Es war ja so, seitdem sie auf der Welt war. Schlimm war hingegen, dass die anderen Kinder, die ohnehin nur wenig mit ihr gesprochen hatten, bald ganz damit aufhörten. Da sie schreiben konnte. Lesen konnte. Jede Frage beantworten konnte. Vor allem aber, weil sie Rechenaufgaben löste, ohne wirklich nachzudenken. Nicht nur die einfachen Additionen, sondern auch schwierige, die ganz hinten im Mathematikbuch waren. Deshalb war sie richtig froh gewesen, als sie in Miss Ruthies Klasse versetzt wurde. Aus der ersten Schulstufe direkt in die dritte. Das war vor Weihnachten gewesen – und hatte nichts geändert.
Die älteren Kinder tuschelten und beäugten sie, wenn sie dachten, dass sie es nicht bemerkte. Tat sie aber. Weshalb sie sich in all den Monaten seither angewöhnt hatte, ihre Traurigkeit und Einsamkeit zu verstecken. Was jedoch nichts daran änderte, dass sie in der Schule zwischen all den anderen Kindern, die doch ihre Freunde sein sollten, allein war.
Sie vermisste Doli tagsüber ganz schrecklich, nachts weniger. Wenn sie im Bett lag und die Augen zumachte und sich auf ihre Atmung konzentrierte, konnte sie sie spüren. Und hier auf der Ranch, ihrem Zuhause, war sie nicht allein. Hier war Mato, der beste Großvater, den sie sich wünschen konnte, obwohl er das nicht wirklich war, und Chayton.
Chayton, der Falke, den Doli immer als ihren großen Bruder bezeichnet hatte. Chayton, der stets für sie beide da gewesen war – und jetzt nur noch für sie.
Sialea-lea liebte ihn genauso sehr wie Mato. Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Im letzten Winter war er nicht wie früher weggefahren, um an einem Projekt in einem Forschungsinstitut zu arbeiten, er war hiergeblieben. Bei Mato und ihr. Zwar hatte er sich stundenlang in seinem Zimmer eingeschlossen und an seinem Schreibtisch zwischen seinen geliebten Zeitungs-stapeln, Karten von Sternbildern und Bergmassiven gearbeitet, doch er war daheim gewesen, wenn sie aus der Schule kam. Aber jetzt war er schon viel zu lange weg.
Sialea-lea war nicht dumm, sie verstand, dass er Tokala, seinem väterlichen Freund, die Bitte nicht hatte abschlagen können. Chayton bezeichnete ihn als weisen Mann, sah zu ihm auf. Tokala Claw war seit langer Zeit Mitglied in der Regierung der Navajo Nation. Er und Mato, früher auch Chaytons Vater, waren unzertrennlich, wie ihre Väter vor ihnen. Sie alle – und auch Chayton — wurden unweit Tsé Bit’a’í geboren und waren an dem Ort aufgewachsen, der in der englischen Sprache Shiprock genannt wurde. Nach dem geflügelten Felsen inmitten des Territoriums des Navajolandes hatte man ihn benannt. Sialea-lea spürte die uralte Energie, die die Männer über große Entfernung hinweg verband, sobald Tokalas Name fiel. Es hieß, dass die männlichen Bewohner des Gebietes von Shiprock die besten Native Guides der ganzen Navajo Nation waren, dem größten Reservat amerikanischer Ureinwohner, obwohl sie dieselbe intensive, Jahre andauernde Ausbildung erhielten wie alle anderen. Tokala, Mato und Chayton zählten immer noch dazu, obwohl sie es nicht hauptberuflich machten. Man blieb ein Führer, unbedeutend, welche Berufslaufbahn man einschlug. Daher hatte Chayton Tokala zugesagt, wie schon andere Male, wenn jemand erkrankte. Nur handelte es sich diesmal nicht um eine Grippe oder Magenverstimmung, sondern einen Beinbruch, und selbst ein unverwüstlicher Navajo konnte mit einem Gips weder einen Jeep fahren noch reiten. Der Mann würde das Bein mindestens drei Wochen nicht belasten können, hatte Chayton ihr erklärt.
Mindestens war ein unheilvolles Wort, Sialea-lea mochte es nicht. Das klang nach unendlich viel, dabei waren schon drei Wochen schrecklich lang. Außerdem hatten Chayton und Mato gestritten, bevor er weggefahren war. Die beiden telefonierten nicht einmal miteinander. Hätte Sialea-lea nicht Dolis Handy, das sie jeden Abend einschaltete, um zu warten, bis Chayton ihr eine Nachricht schickte, würde auch sie nichts von ihm hören. Niemals würde er anrufen, weil er wusste, dass auf dem offiziellen Anschluss der Ranch Mato antworten würde, der das Telefon ständig bei sich hatte. Er und Mato waren beide stur und stolz und eigensinnig, wie Navajo-Männer eben waren. Das hatte Doli immer gesagt.
Navajo-Frauen waren anders – und Nascha ohnehin. Die kam soeben aus dem Haus und stapfte wütend zu ihrem Auto. Sie riss die Tür auf, warf sich auf den Sitz und ließ den Motor aufheulen. Dass sie beim Umdrehen mit dem Heck gegen den Holzstapel fuhr und ein paar Scheite herunterfielen, schien sie gar nicht zu bemerken. Mato hingegen kam aus dem Wohngebäude und sah seiner Nichte kopfschüttelnd hinterher. Dann ging er zu dem Stapel Feuerholz, bückte sich nach einem Holzscheit, legte es obenauf und schaute zur Scheune. Er hob den Blick zum Giebel. »Die Luft ist rein, Sialea-lea. Du kannst kommen. Wir sind wieder allein.«
Sie antwortete nicht. Stattdessen kämpfte sie die Tränen zurück, rappelte sich hoch und klappte das Mathematikheft zu. Sie legte die wunderschöne Decke zusammen, von der sie lediglich wusste, dass sie schon sehr alt war und dass Dolis Großmutter sie vor langer Zeit gewoben hatte. Ihre Urgroßmutter, die Sialea-lea nie kennenlernen würde – und auch sonst niemanden ihrer Verwandten. Doli und sie waren allein gewesen. Sie rollte die Decke ein und schob sie zwischen die Dachbalken. Dann klemmte sie sich das Heft unter den Arm, schloss ihre Faust um den Bleistift und stieg rückwärts über die Leiter hinunter, sprang von der vorletzten Stufe nach unten. Eines der Pferde im angrenzenden Stall trat mit dem Huf gegen die Stallwand. Sicher Nanabah, Chaytons Stute, die ihn ebenfalls vermisste wie Mato und sie selbst. Sie wusste, dass es so war, obwohl der alte Bär kein Wort über Chayton verlor, und genau das war der Hinweis dafür, dass er ihm fehlte.
Sialea-lea ging zur Scheunentür und schaute durch den Spalt nach draußen. Die Holzscheite waren alle wieder auf ihrem Platz. Mato war sicher froh, dass Nascha endlich weg war. Sie auch, aber das war nicht so wichtig, denn Sialea-lea war krank vor Sehnsucht. Sie liebte Mato, und mit ihm zusammen allein zu sein war besser, als in der Schule umgeben von anderen Kindern einsam zu sein. Aber sie wünschte sich von ganzem Herzen, dass die fehlenden Tage, bis Chayton endlich nach Hause kam, rasch vorbeigingen. Er fehlte ihr so sehr.
[…]
Entdecke mehr von Buch-Sonar
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.